SAVE THE DATE
We will hold our next General Assembly for all PalMod Members on
Mon. 16.6. and Tue. 17.6.2025 @ MARUM in Bremen.
This is the link to the registration page.
Here you find the preliminary version of the agenda.
PalMod (and PalMod related) presentations @ EGU2025, 27.4 - 2.5.25, Vienna
PalMod Papers from 2025:
Duque-Villegas, M., Claussen, M., Kleinen, T., Bader, J. & Reick, C. (2025). Pattern scaling of simulated vegetation change in North Africa during glacial cycles. Climate of the Past, 21(4), 773-794, https://cp.copernicus.org/articles/21/773/2025/
Song, P., Scholz, P., Knorr, G. et al. Regional conditions determine thresholds of accelerated Antarctic basal melt in climate projection. Nat. Clim. Chang. (2025). https://doi.org/10.1038/s41558-025-02306-0
Adam, M., Kleinen, T., May, M. & Rehfeld, K. (2025). Land conversions not climate
effects are the dominant consequence of sun-driven CO2 capture, conversion and
sequestration. Environmental Research Letters, 20: 034011. doi:10.1088/1748-9326/ada971
Braschoss, L., Weitzel, N., Baudouin, J.-P., and Rehfeld, K.: State-dependency of dynamic and thermodynamic contributions to effective precipitation changes, Journal of Climate, 38, 731-748, doi.org/10.1175/JCLI-D-24-0355.1, 2025.
Rietkerk, M., Skiba, V., Weinans, E., Hébert, R., Laepple, T.: Ambiguity of early warning signals for climate tipping points. Nat. Clim. Chang. (2025). https://doi.org/10.1038/s41558-025-02328-8
Mikolajewicz, U., Kapsch, M.-L., et al., 2025: Deglaciation and abrupt events in a coupled comprehensive atmosphere–ocean–ice-sheet–solid-earth model, Clim. Past, 21, 719–751, https://doi.org/10.5194/cp-21-719-2025.
Andernach, M., Kapsch, M.-L., and Mikolajewicz, U., 2025: Impact of Greenland Ice Sheet disintegration on atmosphere and ocean disentangled, Earth Syst. Dynam., 16, 451–474, https://doi.org/10.5194/esd-16-451-2025.
Ziegler, E., Weitzel, N., Baudouin, J.-P., Kapsch, M.-L., et al., 2025: Patterns of changing surface climate variability from the Last Glacial Maximum to present in transient model simulations, Clim. Past, 21, 627–659, https://doi.org/10.5194/cp-21-627-2025.
Baudouin, J.-P., Weitzel, N., May, M., Jonkers, L., Dolman, A. M., and Rehfeld, K.: Testing the reliability of global surface temperature reconstructions of the Last Glacial Cycle with pseudo-proxy experiments, Clim. Past, 21, 381–403, https://doi.org/10.5194/cp-21-381-2025, 2025.
Niu, L., Knorr, G., Ackermann, L., Krebs-Kanzow, U., Lohmann, G.: Eurasian ice sheet formation promoted by weak AMOC following MIS 3. npj Clim Atmos Sci 8, 85 (2025). https://doi.org/10.1038/s41612-025-00982-5
Schild, L., Ewald P., Li C., Hébert R., Laepple, T. & Herzschuh, U.: „LegacyVegetation: Northern Hemisphere reconstruction of past plant cover and total tree cover cover from pollen archives of the last 14 ka“. Earth System Science Data, 2025, https://doi.org/10.5194/essd-2023-486.
Trombini, I., Weitzel, N., Valdes, P. J., Baudouin, J.-P., Armstrong, E., and Rehfeld, K.: Atmospheric and Oceanic Pathways Drive Separate Modes of Southern Hemisphere Climate in Simulations of Spontaneous Dansgaard-Oeschger-Type Oscillations, Geophysical Research Letters, 52, e2024GL111473, doi.org/10.1029/2024GL111473, 2025.
Zhang, Z., Poulter, B., Melton, J., Riley, W., Allen, G., Beerling, D., Bousquet, P., Canadell, J., Fluet-Chouinard, E., Ciais, P., Gedney, N., Hopcroft, P., Ito, A., Jackson, R., Jain, A., Jensen, K., Joos, F., Kleinen, T., Knox, S., Li, T., Li, X., Liu, X., McDonald, K., McNicol, G., Miller, P., Müller, J., Patra, P., Peng, C., Peng, S., Qin, Z., Riggs, R., Saunois, M., Sun, Q., Tian, H., Xu, X., Yao, Y., Xi, Y., Zhang, W., Zhu, Q., Zhu, Q. & Zhuang, Q. (2025). Ensemble estimates of global wetland methane emissions over 2000-2020. Biogeosciences, 22(1), 305-321. doi:10.5194/bg-22-305-2025.
Neues PalMod Highlight Paper
Ein neuer Mechanismus zur Synchronisierung von Heinrich-Ereignissen mit Dansgaard-Oeschger-Zyklen
Die Klimaentwicklung während der letzten Eiszeit (ca. 65.000-15.000 Jahre vor heute) wurde von zwei prominenten Signalen der Klimavariabilität geprägt: den Dansgaard-Oeschger Zyklen und den Heinrich-Ereignissen. Dansgaard-Oeschger Zyklen sind bekannt als immer wieder auftretende abrupte Temperaturanstiege und -abnahmen, während Heinrich-Ereignisse ausgelöst durch Instabilitäten vom Laurentidischen Eisschild mit einem Eintrag von großen Mengen an Eisbergen in den Nordatlantik assoziiert sind. Hierbei treten die Heinrich-Ereignisse überwiegend während der Kaltphase der Dansgaard-Oeschger Zyklen auf. Dies deutet auf einen engen Zusammenhang der beiden Ereignisse hin, wobei die genauen Mechanismen bis heute ungeklärt sind. In einer aktuellen Studie stellen Schannwell et al. einen neuen Mechanismus vor, der erklärt, wie Heinrich-Ereignisse mit Dansgaard-Oeschger-Zyklen synchronisiert werden.
Für die Präsentation des neuen Mechanismus stützen Schannwell et al. sich auf Simulationen mit einem gekoppelten Eisschild-feste Erde Modell, das mit einem idealisierten Dansgaard-Oeschger Zyklus angetrieben wird. Der neue Mechanismus überwindet Defizite von früheren Theorien und reproduziert erfolgreich alle Hauptmerkmale von Heinrich-Ereignissen aus der Paläoaufzeichnung für ein breites Spektrum an Klimaantrieben. Ausgelöst werden die Heinrich-Ereignisse hierbei durch interne Eisschildinstabilitäten. Das Auftreten dieser Instabilitäten kann durch atmosphärische Störungen (z.B. Schneefall und Oberflächentemperatur), hervorgerufen durch den periodischen Dansgaard-Oeschger Zyklus, mit der Abkühlungsphase des Dansgaard-Oeschger Zyklus synchronisiert werden. Der atmosphärische Mechanismus ermöglicht eine eisschildweite Reaktion, die das Auftreten von synchronen Heinrich-Ereignissen von zwei unterschiedlichen Eisströmen erlaubt. Das ist ein Merkmal der Paläoaufzeichnung, das frühere Theorien, die hauptsächlich auf Störungen vom Ozean basieren, bisher nicht erklären konnten.
Ein entscheidender Vorteil des atmosphärischen Mechanismus ist, dass er sowohl auf Eisströme, die überwiegend auf dem Land enden, als auch auf Eisströme, die dauerhaft im Kontakt mit dem Ozean sind, anwendbar ist. Daher eröffnet der Mechanismus die Möglichkeit nicht nur Erkenntnisse über episodische Gletscherbeschleunigungen in der Vergangenheit, wie z.B. die Heinrich-Ereignisse, zu gewinnen, sondern auch über heutige episodische Beschleunigungen, wie z.B. beobachtet bei Gebirgsgletschern und Eisströmen vom grönländischen und antarktischen Eisschild.
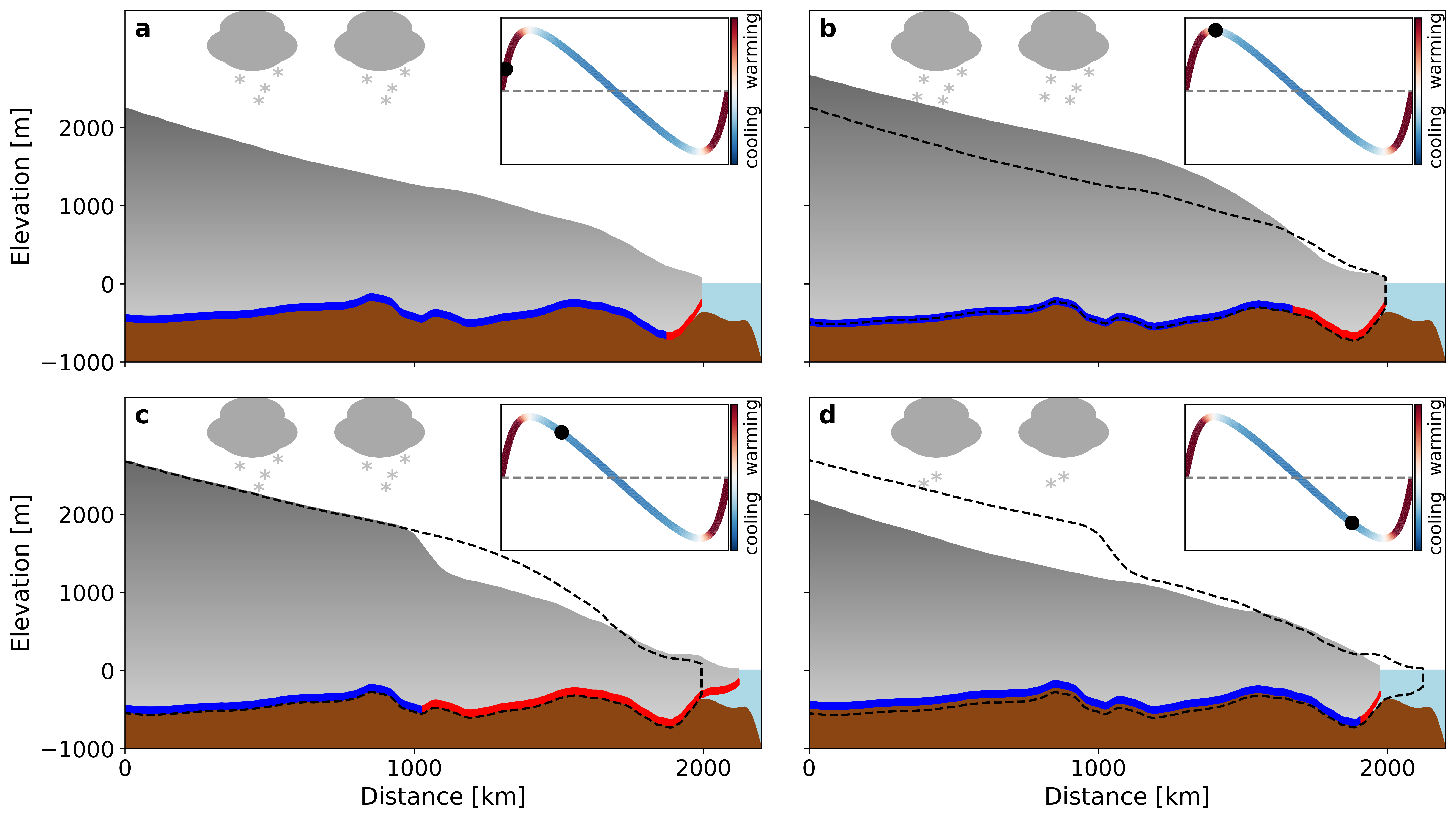
Abbildung: Die Phasen des Heinrich-Ereignisses. (a) Verstärkte Aufbauphase des Eisstroms während des Interstadials. (b) Der Eisstrom erreicht die kritische Eisdicke und Temperaturschwelle für ein Heinrich-Ereignis während des Interstadials. (c) Einsetzen des Heinrich-Ereignisses während des späten Interstadials. (d) Abklingen des Heinrich-Ereignisses am Ende des Stadials. Der gestrichelte Umriss zeigt die Position der vorherigen Momentaufnahme. Die rote Farbe am unteren Ende des Eisstroms zeigt Regionen, in denen sich das Eis am Druckschmelzpunkt befindet, während die blaue Farbe Regionen zeigt, in denen das Eis am Boden festgefroren ist. Die Einfügungen zeigen den ungefähren Zeitpunkt der aktuellen Momentaufnahme innerhalb des Dansgaard-Oeschger-Zyklus
Originalveröffentlichung
Schannwell, C., Mikolajewicz, U., Kapsch, M.-L., Ziemen, F. (2024). A mechanism for reconciling the synchronisation of Heinrich events and Dansgaard-Oeschger cycles. Nature Communications 15, 2961, https://doi.org/10.1038/s41467-024-47141-7
-----
Rasches Wachstum des Landeises durch sommerliche Schneefälle
Während des letzten glazialen Maximums (LGM, vor ca. 21.000 Jahren) bedeckte der Laurentidische Eisschild große Teile Nordamerikas und erreichte eine Eisdicke von mehr als 3 km, bevor dieser schließlich mit dem Ende der Eiszeit geschmolzen ist. Bislang gibt es nur wenige detaillierte Studien über die Entwicklung des nordamerikanischen Eisschildes zum LGM. In einer neuen Studie, die in der Zeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurde, haben Forschende des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) ein neu entwickeltes Klima-Eis-Modell verwendet, um Rückschlüsse auf seine räumliche Ausdehnung ziehen zu können. Sie haben herausgefunden, dass vor allem der Schneefall im Sommer das Wachstum des Eisschildes begünstigte und den Meeresspiegel beeinflusste.
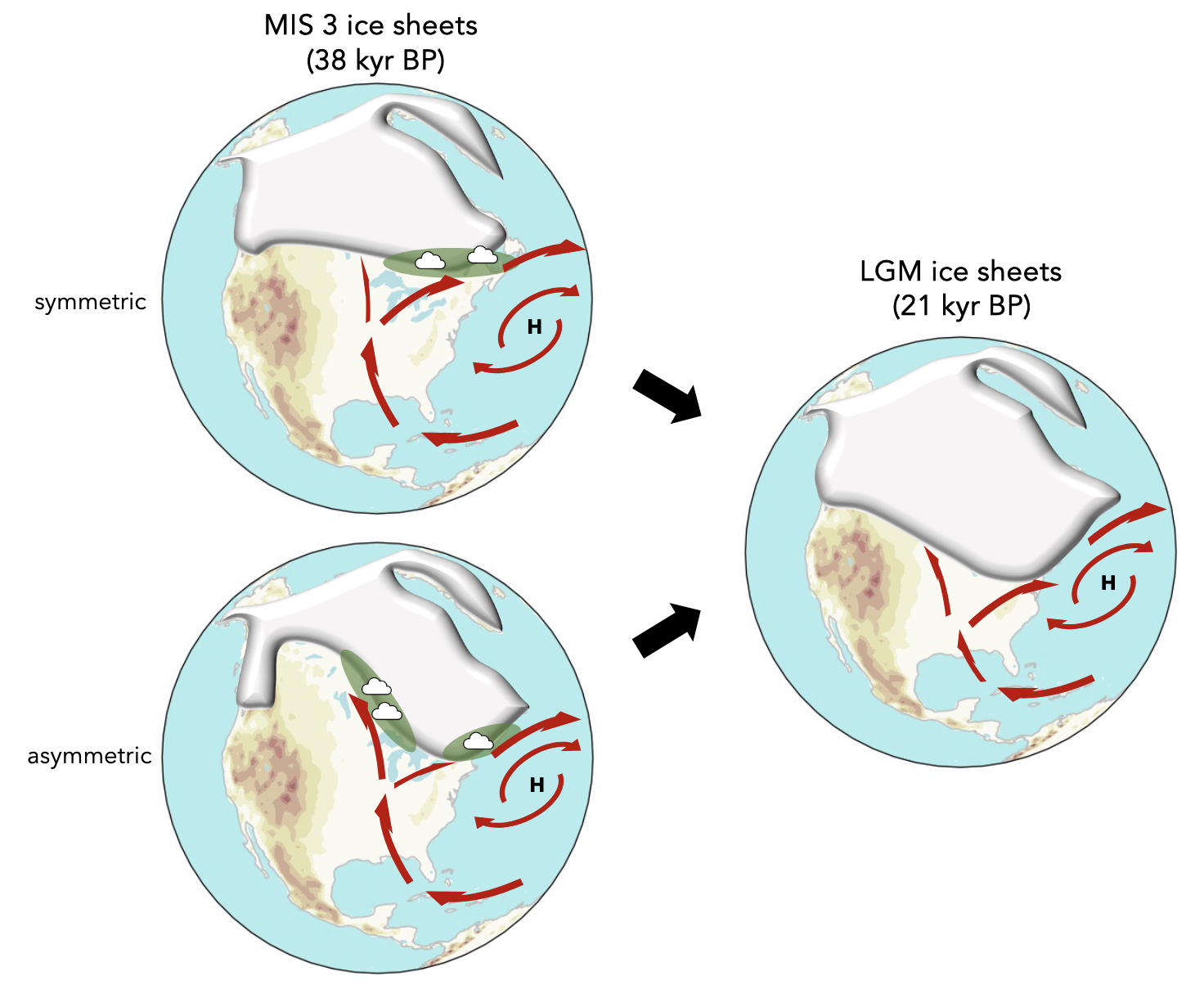
Abbildung: Schematische Darstellung des dominanten Mechanismus zur Ausprägung eines Hochglazialen Eispanzers trotz substanzieller Unterschiede zu Beginn der jeweiligen Simulationen. H repräsentiert das Azoren Hoch und die roten Pfeile den sommerlichen Transportweg atmosphärischer Feuchte mit den assoziierten Hauptniederschlagsgebieten entlang des Eisschildes in Grün. Die ins Zentrum gerichtete Strömung ist dabei im Fall der zonal heterogenen Eisschildkonfiguration besonder ausgeprägt (unten links) und führt dort zu hohen Akkumulationsraten (angepasste Version der Abbildung 6 des Artikels von Niu et al., 2024).
Quelle: AWI press release
Originalveröffentlichung:
L. Niu, G. Knorr, U. Krebs-Kanzow, P. Gierz, G. Lohmann: Rapid Laurentide Ice Sheet growth preceding the Last Glacial Maximum due to summer snowfall, Nat. Geosci. (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41561-024-01419-z
